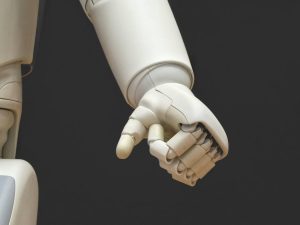Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Flaute rechnet die Bundesregierung für 2026 wieder mit mehr Dynamik: Statt Stagnation soll ein Wachstum von 1,3 Prozent die Wende bringen, 2027 sollen es sogar 1,4 Prozent sein. Für das laufende Jahr bleibt die Prognose allerdings mager – gerade einmal 0,2 Prozent Zuwachs erwartet Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).
Treiber der Erholung ist diesmal nicht der Export, sondern der Binnenkonsum. Stabilere Preise, steigende Löhne und höhere verfügbare Einkommen sollen den privaten Konsum ankurbeln, während massive staatliche Investitionen in Infrastruktur, Klima und Verteidigung zusätzlich für Wachstum sorgen. Doch genau hier sieht Reiche auch das Problem: „Ein erheblicher Teil des Wachstums wird voraussichtlich aus hohen staatlichen Ausgaben stammen“, warnt sie.
Damit dieser Impuls nicht verpufft, drängt die Ministerin auf tiefgreifende Reformen: Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt, Energiekosten gesenkt, Bürokratie abgebaut und Investitionen steuerlich attraktiver gemacht werden. Nur so könne Deutschland langfristig konkurrenzfähig bleiben.
Risiken bleiben jedoch groß. Die Bundesregierung warnt vor einer „sprunghaften US-Handelspolitik“, möglichen Gegenmaßnahmen wichtiger Partnerländer und einer Zuspitzung geopolitischer Krisen. Auch eine schwächelnde Weltwirtschaft könnte die zarten Erholungssignale schnell zunichtemachen.
Damit steht fest: Der erwartete Aufschwung ist weniger das Ergebnis einer starken Wirtschaftskraft als vielmehr einer staatlich befeuerten Zwischenlösung – und sein nachhaltiger Erfolg hängt entscheidend davon ab, ob Berlin die überfälligen Strukturreformen endlich anpackt.