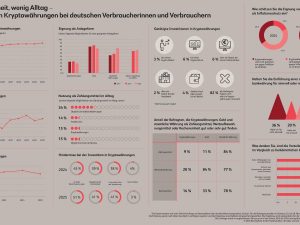Bemerkenswert: Obwohl der Anteil der Barzahlungen im Einzelhandel sinkt – 2023 wurden nur noch ein Viertel der Umsätze bar abgewickelt – wächst die physisch umlaufende Geldmenge weiter. Dieses scheinbare Paradox erklären Notenbanker mit einem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis. Seit der Finanzkrise, beschleunigt durch Pandemie, Inflation und geopolitische Unsicherheit, halten viele Menschen Bargeld als Wertaufbewahrungsmittel. Der „Hoarding“-Anteil am gesamten Bargeldumlauf lag 2024 bei 42 Prozent, wie die Bundesbank mitteilt.
Auch internationale Faktoren spielen eine Rolle. Johannes Gärtner, Zahlungsexperte bei Strategy&, verweist auf die Verwendung des Euro als Reservewährung im Ausland sowie auf die Bedeutung von Bargeld in der Schattenwirtschaft. Gerade illegale Aktivitäten wie Schwarzarbeit oder Geldwäsche bleiben stark auf Bargeld angewiesen – und sie lassen sich schwer quantifizieren.
Ein Beispiel aus der Praxis liefert die Polizei in Bayern: Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A3 entdeckten Schleierfahnder im November eine Million Euro in Plastiktüten – mutmaßlich aus kriminellen Geschäften. Solche Funde seien keine Einzelfälle, sondern Teil eines strukturellen Musters, so Experten aus dem Justiz- und Sicherheitsbereich.
Selbst im Einzelhandel ist Bargeld noch nicht verschwunden, obwohl die Effizienzvorteile bargeldloser Zahlungen offensichtlich sind. „Kontaktloses Zahlen ist bis zu siebenmal schneller als mit Bargeld“, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Dennoch bleibt das Vertrauen in physisches Geld, besonders in Krisenzeiten, tief verankert – ein psychologisches Phänomen mit wirtschaftlicher Wirkung.